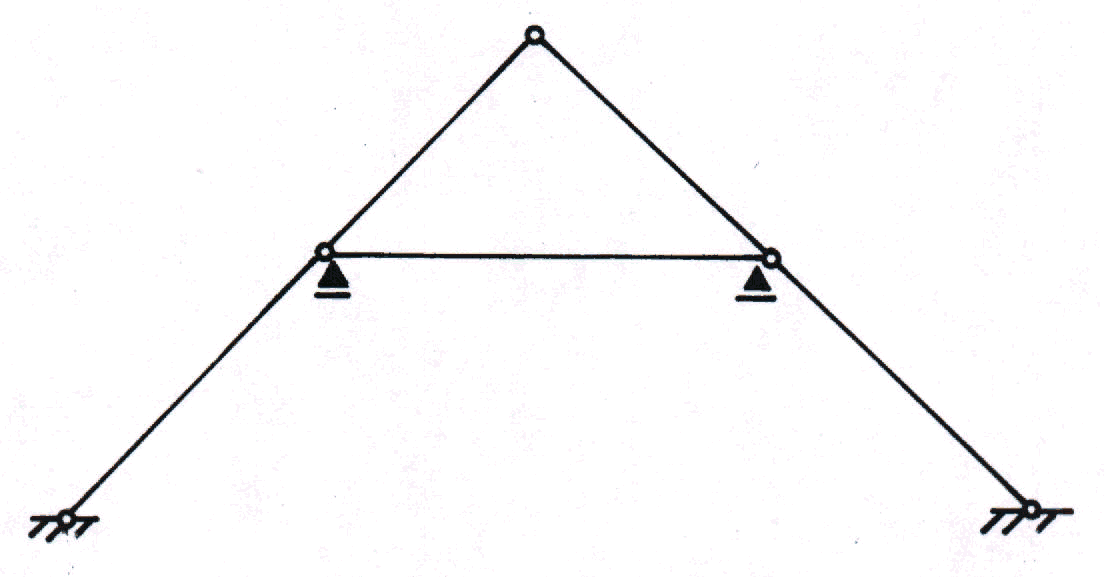
Vortragsmanuskript
Vorliegendes Manuskipt wurde für einen Vortrag im Jahr 1999 als HTM-Seite ins Netz gestellt. Die Umwandlung in ein PDF-Dokument erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt.
Hausdächer - praktische Erfahrungen bei der Modellbildung
Einleitung
In früheren Zeiten wurden Dachtragwerke durch Zimmerleute auf Grund Jahrhunderte alter Erfahrungsschätze ohne statische Berechnungen errichtet. Wir wundern uns heute immer wieder über die Fähigkeiten unserer Vorfahren. Wenn wir aber ehrlich darüber nachdenken, warum wir viele alte Dächer bewundern können, dann müssen wir zugeben, daß bei der natürlichen Selektion die weniger standsicheren Tragwerke schon längst abgetragen sind.
Darüber hinaus kommt den Zimmerleuten ein ganz besonderer Umstand zur Hilfe, nämlich die mechanischen Eigenschaften des Holzes.
Während wir nach der DIN 1052 für Nadelschnittholz der Güteklasse II eine zulässige Spannung von 10 N/mm² ansetzen dürfen, ist die tatsächliche Tragfähigkeit viel höher.
("Die Makrostruktur (Äste, Faserneigung) gibt Aufschluß über die Zugfestigkeit in Faserrichtung, die von über 100 N/mm² bei fehlerfreiem Holz auf unter 10 N/mm² bei Bauholz geringer Qualität zurückgehen kann" aus INFORMATIONSDIENST HOLZ: Holzbauwerke nach Eurocode 5 - STEP 1: Bemessung und Baustoffe, Holz als Baustoff von Prof. P. Hoffmeyer)
Die so entstehenden Tragreserven täuschen häufig darüber hinweg, daß mancher Riß in Bauwerken durch Unzulänglichkeiten in der Dachkonstruktion hervorgerufen wird.
Der Vortrag wird sich auf einige Aspekte konzentrieren, die der Tragwerksplaner in seinem unmittelbaren Betätigungsfeld berücksichtigen sollte. Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit den praktischen Problemen sollen 2 reale Beispiele sein.
Die Brisanz des Themas wird deutlich, wenn man weiß, daß in beiden Fällen Prüfingenieure beteiligt waren.
1. Fehler bei der Planung eines Kehlbalken (Beispiel 1):
Vor einigen Jahren wurde ich als Gutachter zur Abnahme eines Einfamilienhauses hinzugezogen. Das Wohnhaus hatte sehr viele Mängel. In einem Beitrag für das Bundesbaublatt Heft 2/96, zu lesen auch im Internet auf der Homepage meines Büro (www.ingjahn.de), wurde ein zusammengefaßter Überblick über das Ausmaß der Unzulänglichkeiten wiedergegeben.
Ein Fehlerschwerpunkt lag auch im Dachbereich. In der Genehmigungsstatik hatte der Tragwerksplaner folgendes System (Abb. 1.1) berechnet:
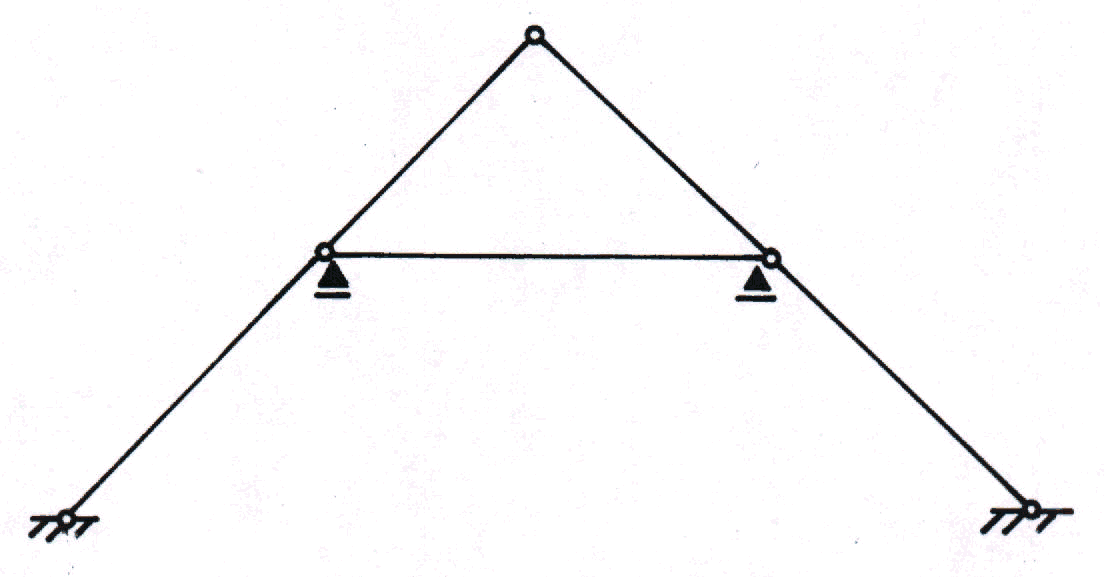
Grundsätzlich gibt es an der Berechnung der Binders keine Kritik. Der Fehler liegt jedoch bei der Ableitung der Horizontallasten. In den weiteren Berechnungen gibt es keinerlei Hinweise auf eine Weiterleitung waagerechter Lasten in die Deckenscheibe. In den Zeichnungen war lediglich die Ausbildung eines bewehrten Auflagerbalkens, der in eine U-Schale betoniert werden soll, dargestellt (Abb. 1.2).
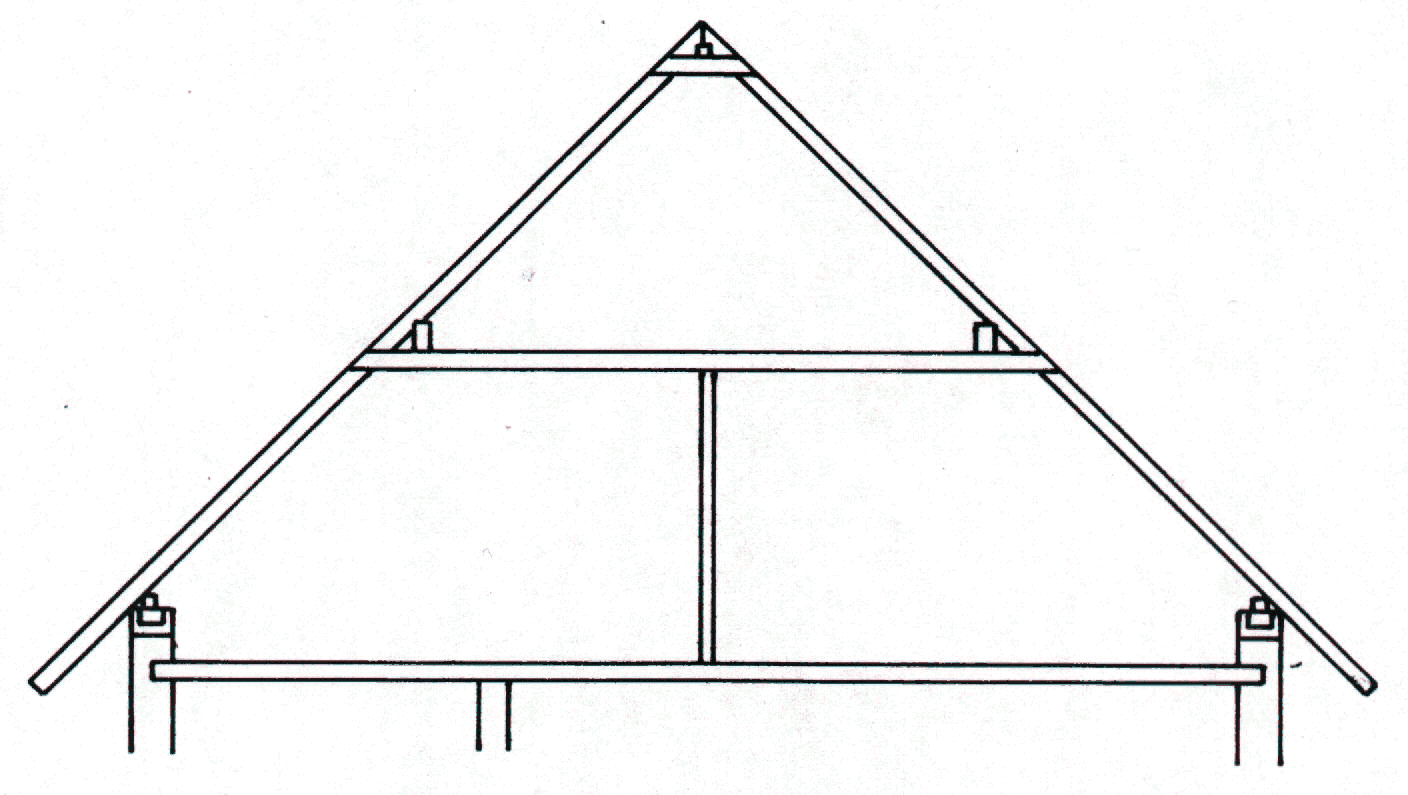
Auf Grund einer Nachfrage wurde vom Tragwerksplaner ein 2. System (Abb. 1.3) vorgelegt. Er begründet dies mit der Aussage, daß die Horizontalkräfte an den Fußpunkten im ursprünglichen System nur aus dem Lastfall Wind und nicht aus den Lastfällen Eigengewicht, Schnee und Verkehrslast herrührten.
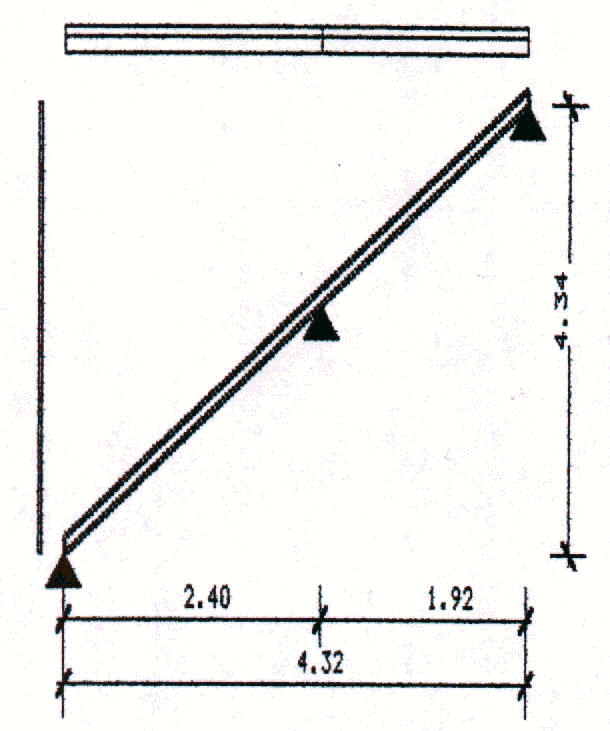
Im Ergebnis einer 3. Nachfrage wurde ein weiteres Tragwerkssystem (Abb. 1.4) offeriert.
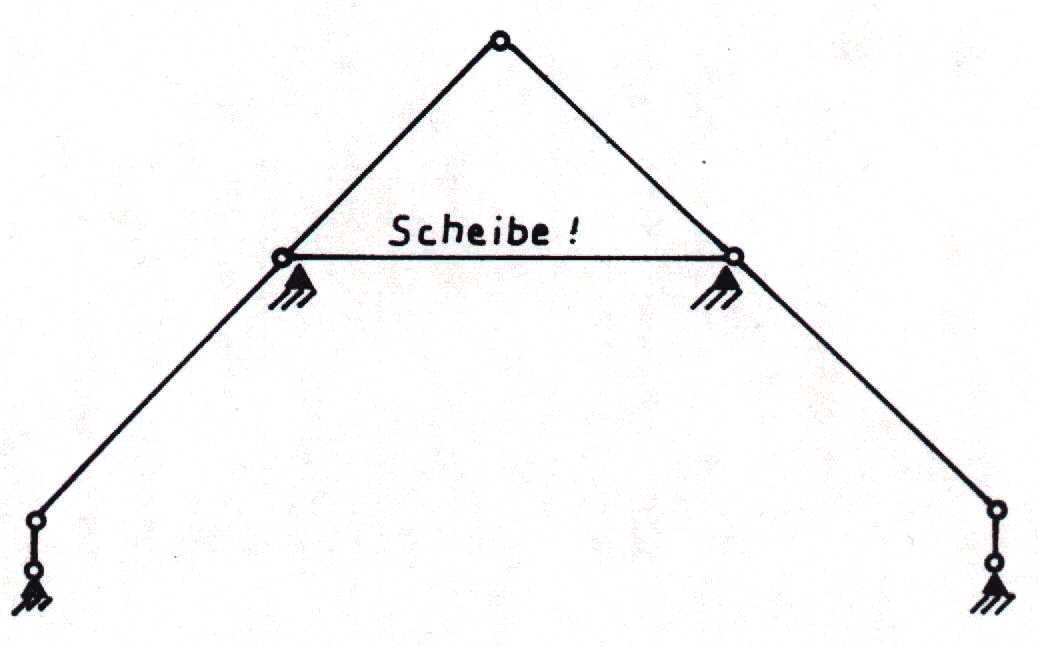
Im Schriftverkehr betonte der Statiker, daß er eine 17-jährige Berufserfahrung habe, wobei er 14 Jahre als verantwortlicher Prüfstatiker in einem Bauordnungsamt gearbeitet hätte.
Gerade unter dem letztgenannten Aspekt erscheint die Problematik in einem sehr bedenklichen Licht.
zum Tragwerksmodell nach Abb. 1.1:
Können die horizontalen Lasten auf dem Fußpunkt abgeleitet werden?
Der Lösungsvorschlag geht von der Anordnung eines Ringbalkens aus. Damit muß von einem waagerecht gespannten Balken ausgegangen werden. Er reicht von einem Giebel zum anderen. Im vorliegenden Falle hat er eine Spannweite von 9,65 m
Eine U-Schale aus Porenbeton für eine Wandstärke von 365 mm hat eine lichte Querschnittsbreite von 160 mm. Unter Berücksichtigung eine Betondeckung von 20 mm und einem halben Stabquerschnitt von 5 mm ergibt sich eine Nutzquerschnittshöhe des horizontal beanspruchten Deckenbalkens von 13,5 cm. Die zulässige Schlankheit für Stahlbetonbalken beträgt nach der DIN 1045 l/h = 35. Hier liegt dieses Verhältnis mit 965 / 13,5 = 71,5 um 100 % über dem vorgeschriebenen Wert.
zum Tragwerksmodell nach Abb. 1.3:
Diese Systemlösung beschreibt das Tragwerk völlig unzutreffend, da ein statisch unbestimmtes System nur unter ganz bestimmten, eng abgegrenzten Randbedingungen aufgelöst werden kann.
zum Tragwerksmodell nach Abb. 1.4:
Diesem System kann man theoretisch folgen. Allerdings müssen auch hier einige wesentlich Aspekte berücksichtigt werden:
Hieraus ergeben sich folgende Hinweise
zu 1.
Die Lage der Stöße sowie die Zahl und Art der Verbindungsmittel ist besonders wichtig
zu 2.
Im allgemeinen bietet sich die Einleitung der Kräfte in die Giebel über die Anordnung von Mittelpfetten an. Dabei stellen die Schubkräfte ein nicht zu unterschätzendes Problem dar.
Punktuelle Krafteinleitungen können zu gefährlichen Spaltzugkräften im Mauerwerk führen. Besonders für die hochdämmenden Mauermaterialien aus Porenbeton oder Ziegeln sind in der Regel kaum Festigkeitsnachweise in dieser Hinsicht möglich.
Hier sollte man über eine linienförmige Lasteintragung mit Hilfe ausbetonierter bewehrter U-Schalen als Auflagerbalken helfen.
2. Fehler bei der Verstärkung einer Mittelpfette (Beispiel 2):
Das Dachgeschoß eines Mehrfamilienhauses sollte ausgebaut werden. Das Dachtragwerk bestand aus einem unsymmetrischen Pfettendach mit 3-fach stehendem Stuhl (Abb. 2.l).
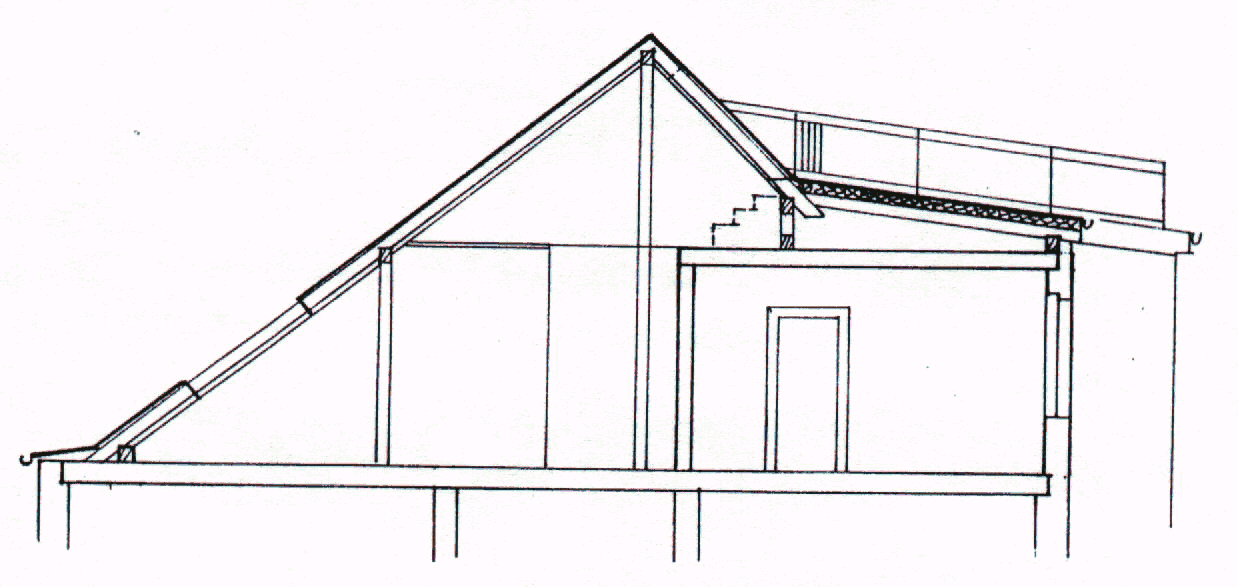
Abb. 2.1 Querschnitt durch das Dachgeschoß
Die Sparren mit dem Querschnitt von 11/12 waren im Abstand von ca. 80 cm angeordnet. Damit ergab sich unter Vernachlässigung der Klaue auf der Mittelpfette eine Spannungsauslastung von 88 % im Lastfall HZ. Dabei wurde die Erhöhung der zulässigen Biegezugspannung um 10 % im Bereich der Mittelunterstützung wegen der Berücksichtigung der Durchlaufwirkung berücksichtigt. Die Vergrößerung einzelner Sparrenabstände zum Zwecke des Einbaues von Wohnraumdachfenstern bis zu 90 cm wäre im Einzelfall vertretbar, wenn bestimmte Randbedingungen eingehalten würden.
Ebenso kritisch stellt sich die Tragfähigkeit der vorhandenen Mittelpfette dar. Durch den Einbau der Dämmung und Bekleidung erhöhte sich die Last aus den Sparren. Außerdem war die Anordnung einer Decke in der Mittelpfettenebene vorgesehen. Neben dem zusätzlichen Deckengewicht war auch die Verkehrslast zu berücksichtigen.
Das ursprüngliche statische System für die Mittelpfette (Abb. 2.2) ist bereits bei der Belastung ohne Dachgeschoßausbau nach den heutigen Normen nicht geeignet, Lasten sicher genug abzuleiten. Am einfachsten ist es, in den Endfeldern zusätzliche Stützen einzubauen (Abb. 2.3).
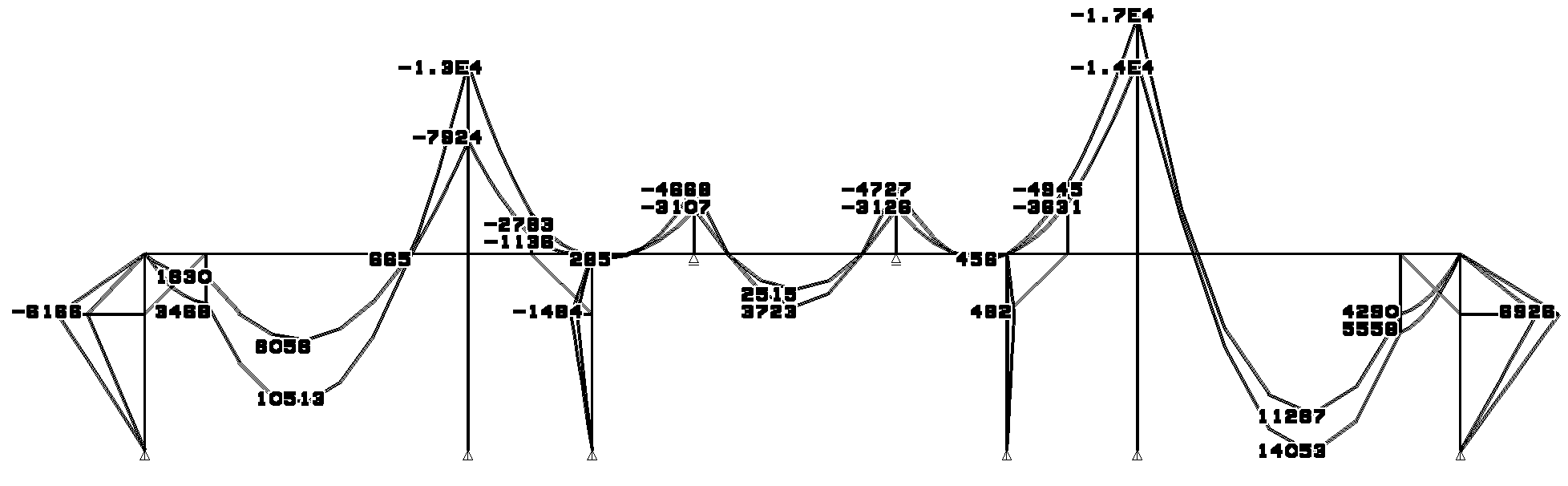
Abb. 2.2: Ursprüngliches statisches System
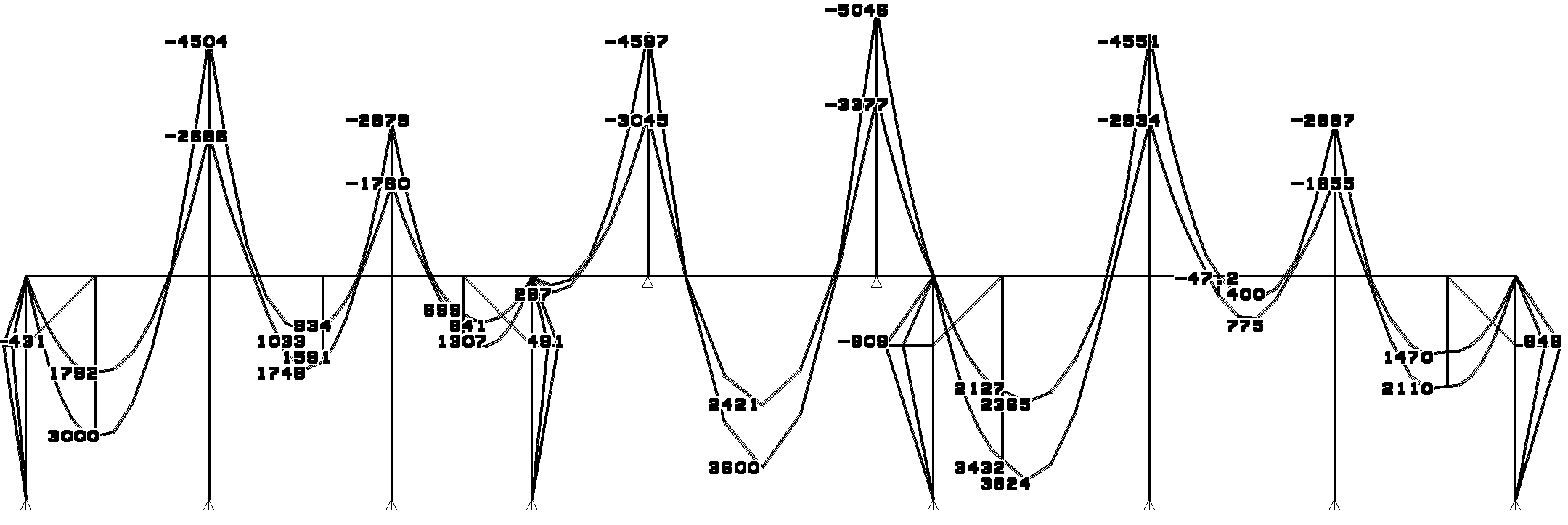
Abb. 2.3 Statisches System mit zusätzlichen Stielen im Endfeld
Durch verschiedene Umstände machte es sich erforderlich, daß eine Anpassung der statischen Berechnung vorgenommen werden sollte. In diesem Zuge war eine Baustellenbesichtigung unerläßlich.
Dabei wurden folgende Probleme festgestellt:
zu 1.
Durch den Eingriff wurde die Mittelpfette teilweise entlastet. Dafür erhöhte sich die Belastung auf die Firstpfette. Durch den Wegfall der Durchlaufwirkung änderte sich zwar die Beanspruchung der Sparren nur unwesentlich, aber die Erhöhung der zulässigen Biegespannung um 10 % war nicht mehr möglich. Somit ergab sich eine Spannungsauslastung von 97 % bei den ausgewechselten Sparren. Bedenkt man jedoch die Tatsache, daß die Hölzer durch Hausbockbefall in ihrer Tragfähigkeit reduziert waren und daß einzelne Sparrenabstände durchaus größer waren, als in der Berechnung angesetzt wurde. Die Tragfähigkeit der Wechsel und Sparren, welche die Lasten aus den Wechseln aufnehmen sollen, ist nicht untersucht worden.
Es kann davon ausgegangen werden, daß die Festigkeitsanforderungen der DIN 1052-01 nicht erfüllt werden können.
zu 2.
Die Basis für die Verstärkungsmaßnahme bildete eine statische Berechnung. Das gewählte System war als Einfeldträger stark vereinfacht. Die Berechnungen wiesen folgende Fehler auf:
Die Nachrechnung ergab, daß jeder der 3 Fehler für sich eine Überschreitung der zulässigen Spannungen zur Folge hatte. Die Beanspruchung der Verbindungsmittel wurde überhaupt nicht untersucht.
Der Gipfel war jedoch die Ausführung. Statt der vorgeschriebenen Dübel vom Typ GEKA wurden Bulldog-Dübel verwendet. Letztere haben jedoch nur 2/3 der Tragfähigkeit. Aber auch dieser Fehler war noch zu überbieten. Der zwischenzeitlich eingeschaltete Tragwerksplaner hatte 14 Verbindungsmittel vorgesehen. In einem Endfeld waren 9 und im anderen 7 Dübel eingebaut. Da zu kleine Unterlegscheiben verwendet wurden, waren diese natürlich unter Zerstörung der Randfasern ins Holz gepreßt.
zu 3.
Die Verstärkung der Deckenbalken erfolgte mit einseitig angesetzten [-Profilen. Zum Zeitpunkt meiner Baubegehung war nicht feststellbar, welche Verbindungsmittel und welche Menge eingesetzt wurden. Die Angaben der Zimmerer waren widersprüchlich und nicht verläßlich.
Besonders kritisch stellten sich die Deckenbalken dar, welche durch die Stiele aus den Pfetten belastet werden.
Aus den Beschreibungen der Handwerker war jedoch nur mit Sicherheit zu entnehmen, daß in unmittelbarer Nähe der Stützen keine Dübel eingebaut wurden.
3. Betrachtungen zu Mischvarianten aus Pfetten- und Kehbalkendächern:
Sehr häufig findet man bei bestehenden Tragwerken von den klassischen Lehrformen abweichende Systeme. Nach der Mitte des vergangenen Jahrhunderts wurden meistens Pfettendächer mit Dachneigungen von 35° bis 45° errichtet. Bis dahin waren Kehlbalkendächer mit unterstützendem Stuhlrahmen eher die Regel.
3.1 Pfettendächer
Als häufigste Form des Pfettendaches in unserem Raum findet man 2-fach stehende Stühle. Sehr oft haben die Häuser einen Kniestock. Diese Variante soll vorerst nicht weiter betrachtet werden.
In der aktuellen Literatur wird zur Dimensionierung der Sparren häufig empfohlen, den Sparren als unten gelenkig angeschlossen und an der Mittelpfette verschieblich gelagert anzunehmen. Diese Betrachtungsweise ist für die Bemessung des Sparrens sicherlich richtig. Die Schnittkräfte liegen immer auf der sicheren Seite. Allerdings müssen für die Bemessung der unterstützenden Teile weitreichendere Überlegungen angestellt werden.
Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, daß Windböcke oft zwar einem 2-stieligem Hängewerk ähneln, jedoch nicht als solche wirksam werden können, da die Anschlußpunkte der Streben in der Regel nicht die enormen Druckkräfte auf den Deckenbalken übertragen können.
Aus grundsätzlichen Überlegungen und eigenen Schnittkraftuntersuchungen am Stabwerksmodell ergaben folgende Praxishinweise:
a) Pfettendächer ohne Windbock:
b) Pfettendächer mit Windböcken:
3.2 Kehlbalkendächer
Diese Tragwerkssystem ist sehr weit verbreitet, da die Dächer stützenfrei sind. Am häufigsten werden die beiden Grundformen mit oder ohne ausgesteiften Kehlbalken angewendet.
Einige Hinweise wurden im 1. Abschnitt dargelegt.
Häufig werden die Kehlbalken unterstützt. Am gebräuchlichsten ist die Anordnung von Pfetten in der Nähe des Anschlußknotens Sparren-Kehlbalken. Ebenso kann man die Wände als Zwischenauflager für die Kehlbalken nutzen.
Die Ableitung der Horizontallasten aus den Kehlscheiben ist genauso wichtig wie die Lastableitung an den Fußpunkten.
3.3 Verformungsuntersuchungen:
Nicht selten wird von Prüfingenieuren auch der Durchbiegungsnachweis von Sparren und Kehlbalkenbindern gefordert. Der Hintergrund ist die Gefahr von Rißbildungen im Anschlußbereich von Beplankungen und parallel zur Binderebene stehenden Wänden.
Prof. Brünninghoff, der federführende Bearbeiter des Kommentars zur DIN 1052, gab mir einmal den Rat dem Prüfer darauf aufmerksam zu machen, daß dessen Job die Standsicherheit nicht die Gebrauchstauglichkeit beinhalte, wenn nicht nach der Theorie II. Ordnung oder der Methode der Grenzzustände bemessen wird.
Die DIN 1052-01 legt im Abschnitt 8.5 bestimmte Grenzwerte fest. Die Verformung der Sparren ist im Abschnitt 8.5.7 für Regelfälle auf 1/300 beschränkt. Im Kommentar sind die Grenzwerte illustriert. Wie vorsichtig man mit diesen allgemein anerkannten Regeln der Technik umgehen muß soll an folgendem Beispiel veranschaulicht werden:
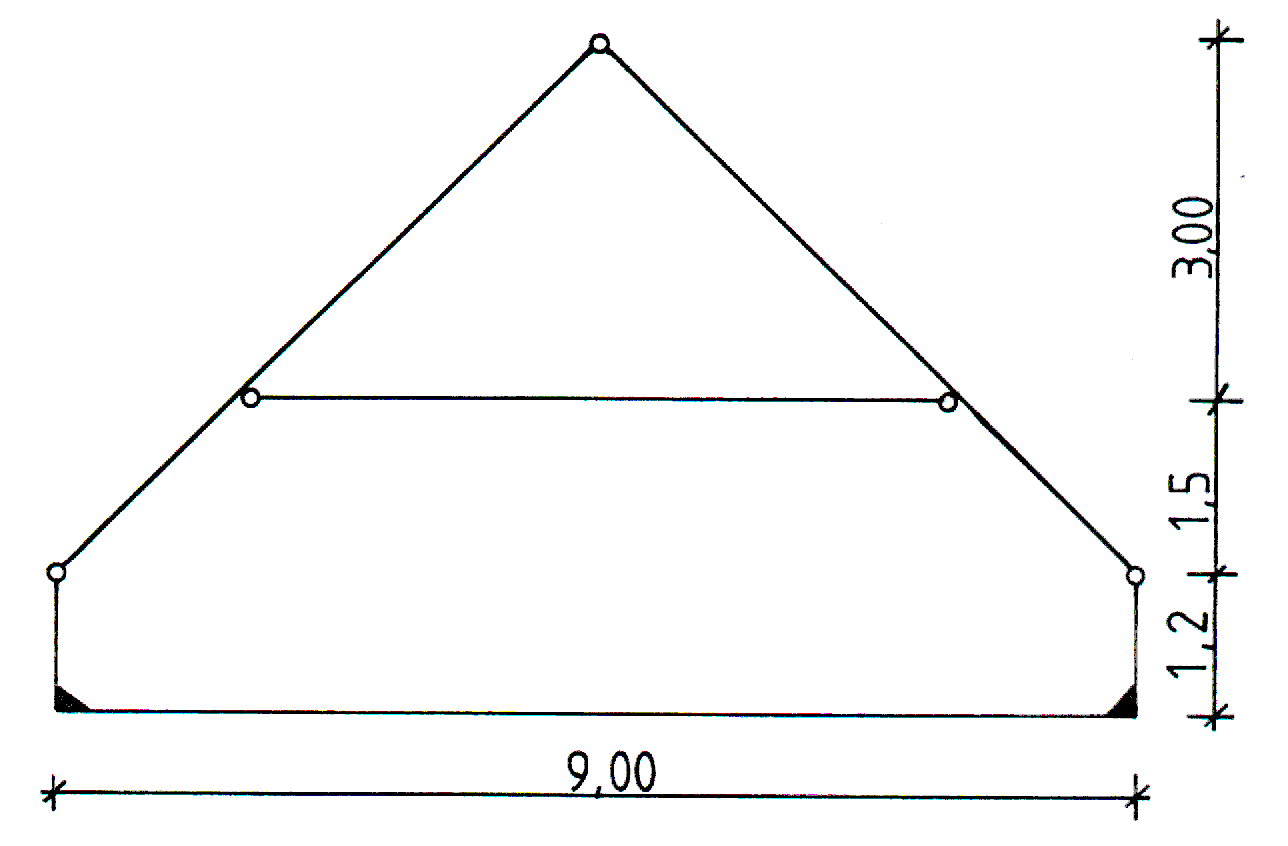
Abb. 3.3-1
Die Durchbiegung des Sparrens dürfte also nicht größer sein als 7 mm. Es ist sicherlich vorstellbar, wenn am Sinn der Festlegung der Verformungsbegrenzung gezweifelt wird. Verschiedene Rechenprogramme für Kehlbalkenbinder bedienen sich einer völlig vernünftigen Vereinfachung. Sie untersuchen nur die Verformungen, die Einfluß auf die oben beschiebene gefährdete Stelle haben, nämlich aus den Lastfällen Schnee und Wind.
4. Verstärkung einer Firstpfette Beispiel 4:
Die Bemessung von Kopfbandbalken darf entsprechend der DIN 1052-01 als einfeldriger Biegeträger mit einer Stützweite entsprechend des größten Abstandes der Kopfbänder erfolgen, wenn die Stützenabstände nicht mehr als 20 % von einander abweichen. Darüber hinaus sollen an den Endstützen keine Kopfbänder angeordnet werden, sondern die Pfetten zum Fußpunkt hin abgestrebt sein.
Da die Stielabstände häufig von den unter dem Dachgeschoß liegenden Querwänden abhängig sind, kommt es zu größeren Abweichungen der Stützweiten untereinander. Besonders bei vorhandenen Dächern ist an den Endstützen bereits ein Kopfband angeschlossen.
Ausgehend von einem existierenden Beispiel sollen einige Lösungsansätze für eine Verstärkung diskutiert werden. Dabei wird vorausgesetzt, daß über den Giebel keine Horizontalkräfte eingeleitet werden. Die Pfette mit den Abmessungen 10/14 und einem Widerstandsmoment von 327 cm³ ist unterdimensioniert. Die Kopfbänder mit sind 3 cm tief eingeschnittenen Stirnversätzen angeschlossen.
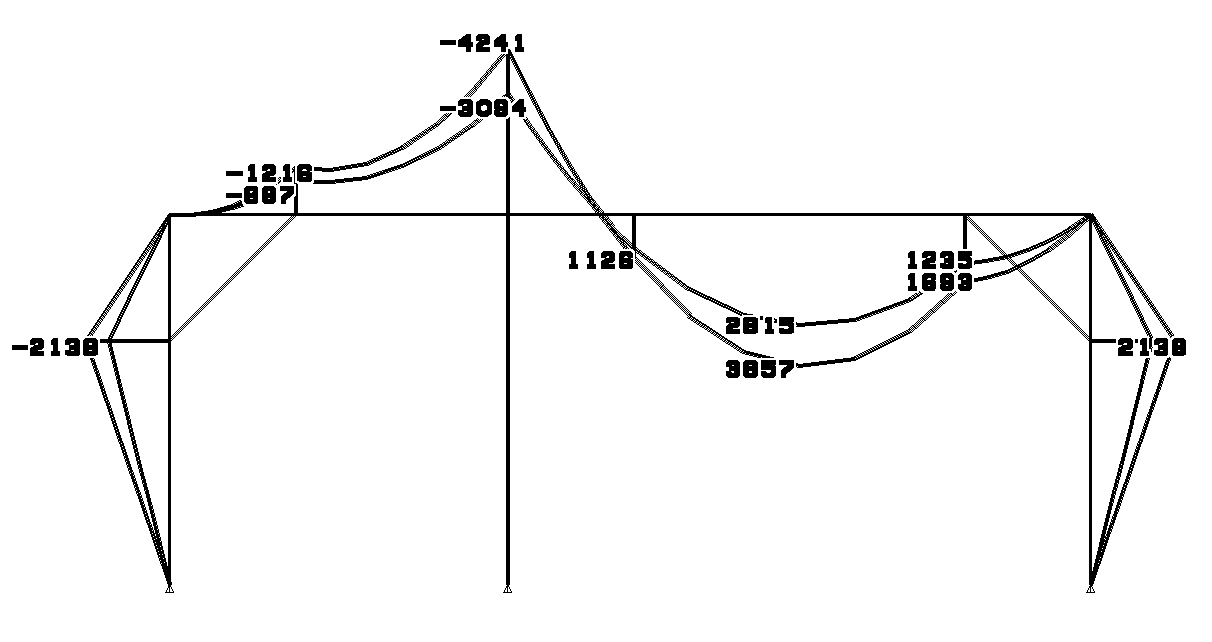
Bild 4.1: Statisches System und Momentenbild im Ausgangszustand
Bei diesem System tritt am Kopfband des größeren Feldes ein positives Biegemoment auf. Damit muß die Querschnittreduzierung durch den Versatz berücksichtigt werden.
Die Endstiele werden durch Biegung mit Längskraft beansprucht.
Durch die Nachgiebigkeit der biegebeanspruchten Stiele wird die Ausbildung der biegesteifen Rahmenecke nur begrenzt wirksam.
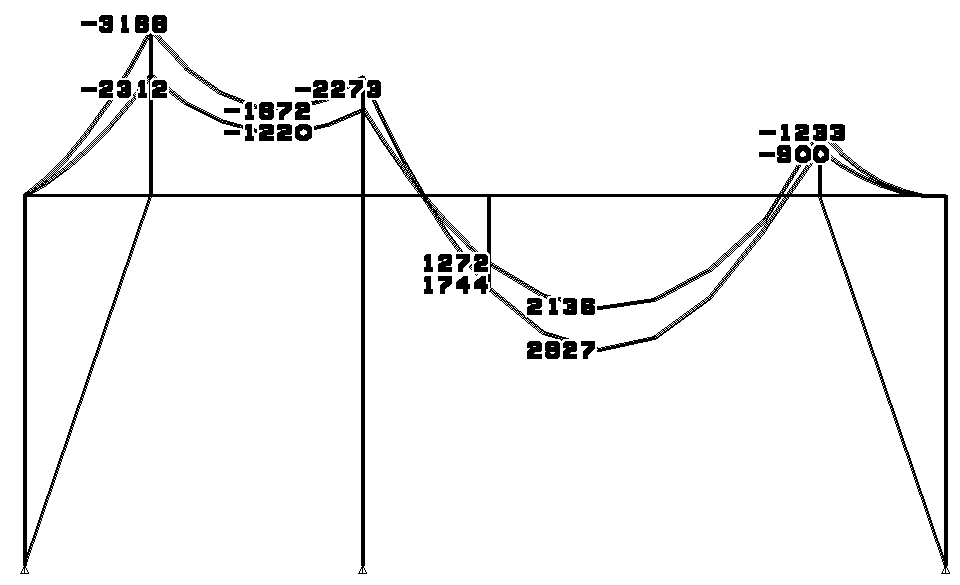
Bild 4.2: Variante 1 - Ersatz der Kopfbänder durch 2 Streben
Der Einbau von Streben verbessert deutlich die Tragwirkung des Systems. Allerdings führt dieses System ebenfalls zur Einleitung von Horizontalkräften in die Deckenbalken. Dem muß bei der Verlegung der Dielen besonders Rechnung getragen werden. Mitunter ist die Anordnung eines Zugbandes unvermeidlich.
Die Ausbildung des Stirnversatzes an der Mittelpfette ist wegen des steileren Neigungswinkel nur mit einem Beiholz möglich. Alternativ könnten auch 2 Bohlen mit Dübeln (z.B. Geka) verwendet werden. In diesem Falle sind auch Futterhölzer erforderlich.
Die Variante 1 ist relativ arbeitsaufwendig.
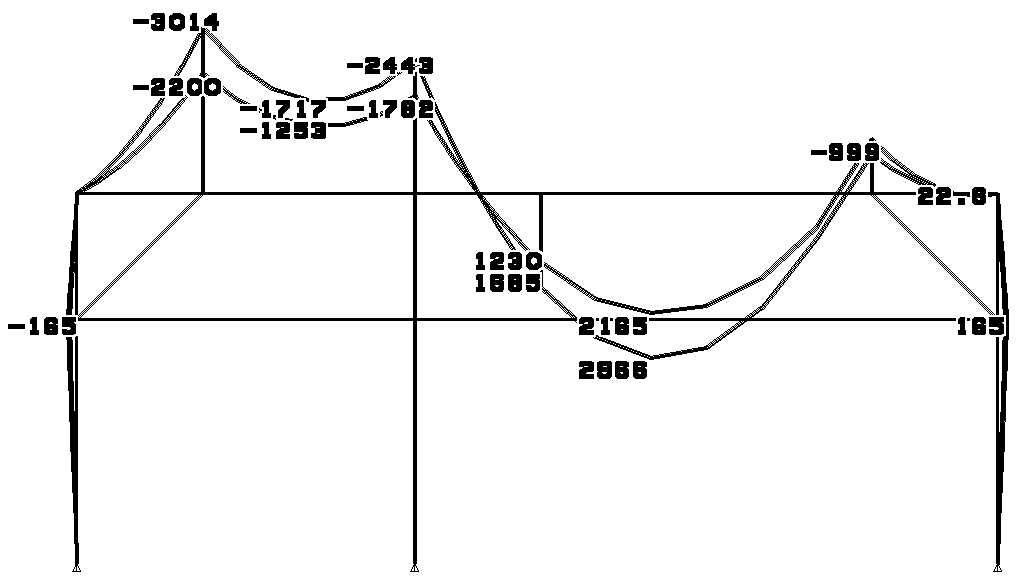
Bild 4.3: Variante 2 - Einbau eines Zugbandes zwischen den Endstielen
Durch den Einbau eines Zugbandes zwischen den Endstielen wird die Einspannung an den Kopfbändern voll wirksam. Die Biegebeanspruchung der Endstiele ist wesentlich verringert. Die vorliegende Lösung ist wegen der relativ hohen Biegemomente im kleinen Feld noch nicht zufriedenstellend.
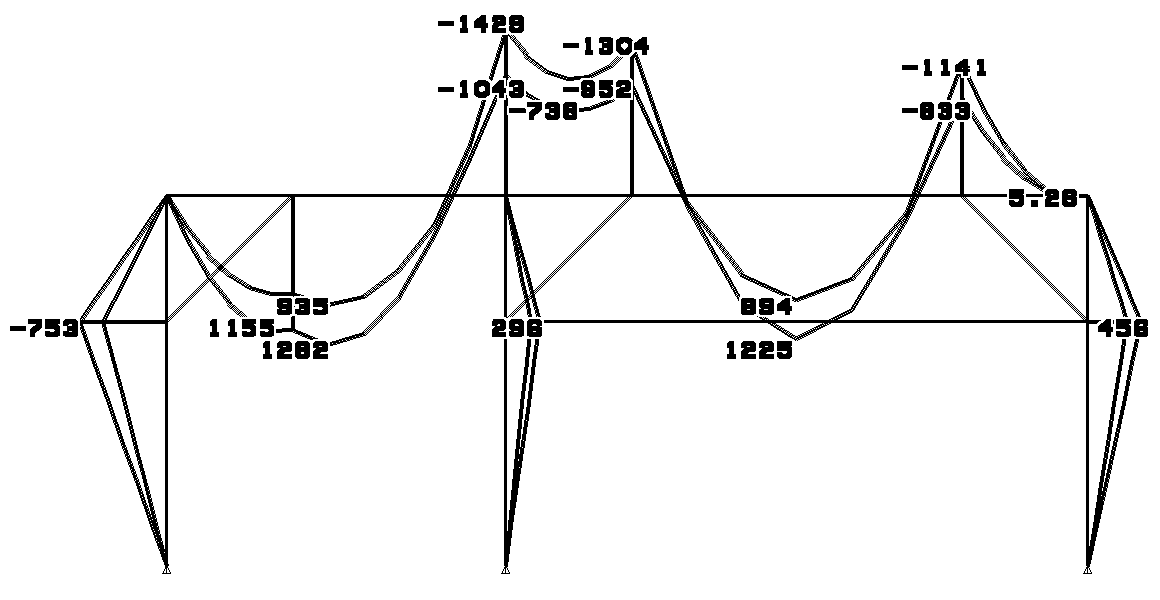
Bild 4.4: Variante 3 - Einbau eines zusätzlichen Kopfbandes im großen Feld, an der Mittelstütze und Anordnung eines Zugbandes im großen Feld
Die Biegemomente werden in allen Bauteilen wesentlich verringert. Trotzdem bleibt die Biegebeanspruchung des Endstiels im kleinen Feld. Die Ableitung der Horizontalkräfte am Fußpunkt darf ebenfalls nicht unberücksichtigt bleiben.
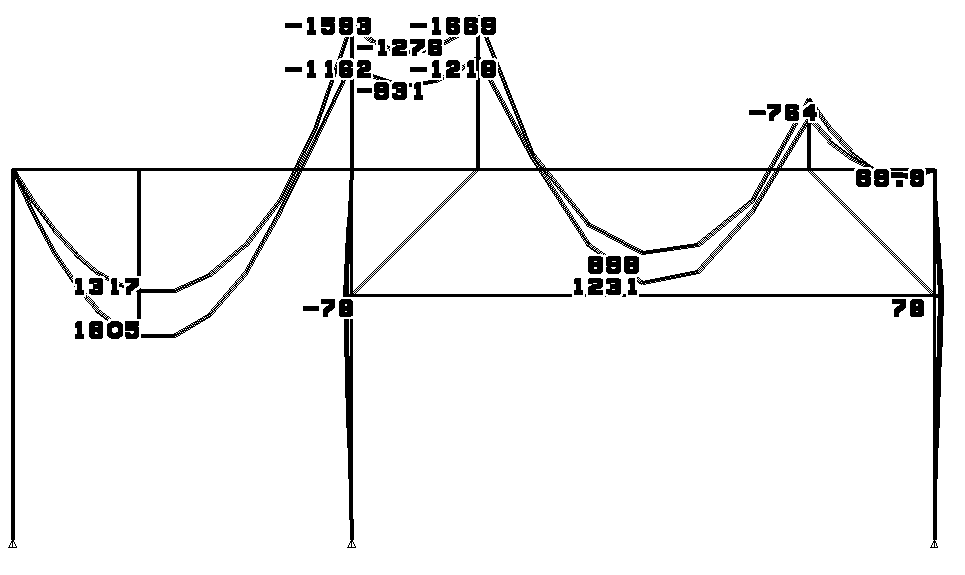
Bild 4.5: Variante 4 - wie 3 jedoch aber Entfernen des Kopfbandes an der Endstütze
Die Horizontallasten an den Fußpunkten sind fast vernachlässigbar. Bei Bedarf kann die Pfette durch eine untergenagelte Bohle sehr einfach verstärkt werden.
Schlußbemerkung
Mit Hilfe der Beispiele sollte gezeigt werden, daß die Wahl des statischen Systems für ein Wohnhausdach einen erheblichen Einfluß auf die Ableitung der Kräfte in die Unterkontruktion hat. Dabei dürfen auf keinen Fall die Horizontalkräfte vernachlässigt werden.
Bei der statischen Untersuchung von Kopfbandträgern als
Unterstützungskonstruktionen von Dächern sollten die
Horizontallasten auf Stiele nicht unterschätzt werden. Sie
werden vornehmlich durch Kopfbänder eingeleitet. Sie bewirken
eine Biegebeanspruchung im Stiel. Die Ableitung der horizontalen
Stützlast am Fußpunkt muß ebenfalls Berücksichtigung finden.
Im Endfeld darf keine Verkürzung der Stützweite vorgenommen
werden, wenn Kopfbänder ohne zusätzliche Versteifungsmaßnahmen
angeordnet werden. Die Anordnung von Zugbändern kann eine
geeignete Maßnahme sein, die Wirksamkeit von Kopfbändern auch
im Endfeld zu verbessern.